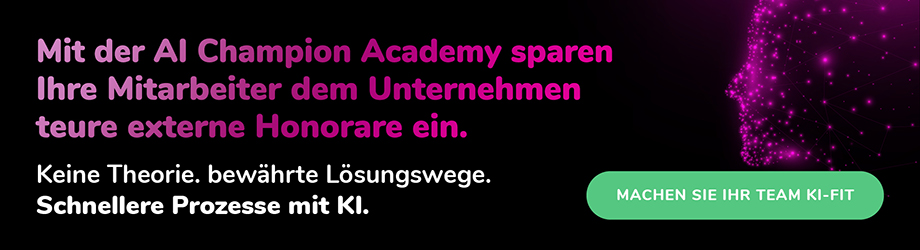Am Rastplatz Lipperland Süd an der Autobahn 2 hat Scania den ersten dauerhaft öffentlich zugänglichen Megawatt-Ladepunkt für batterieelektrische Lkw Deutschlands in Betrieb genommen. Das MCS-System erreicht bis zu 1,2 Megawatt und reduziert kontinuierlich Ladezeiten auf 30 bis 45 Minuten. Das HoLa-Konsortium, gefördert vom Bundesverkehrsministerium und der EU, wird durch Fraunhofer ISI und die P3 Group koordiniert. STI Freight Management Germany und Pape Transporte erproben Scania E-Lkw im täglichen betrieblichen Langstrecken-Fernverkehr.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Scania setzt neuen Standard mit öffentlichem 1,2-Megawatt-Ladepunkt in Bielefeld
An der Rastanlage Lipperland Süd wurde ein öffentlich zugänglicher MCS-Charger installiert, der batterieelektrische Lkw mit bis zu 1,2 Megawatt Ladeleistung versorgt. Das modulare System nutzt moderne Hochvolttechnologie, um Ladezyklen auf 30 bis 45 Minuten zu komprimieren. Dank intelligenter Leistungssteuerung und thermischem Management werden Netzbelastung sowie Überhitzungsrisiken minimiert. Dieses Konzept gewährleistet kurze Standzeiten, hohe Verfügbarkeit und schafft die Voraussetzung für eine effiziente Elektrifizierung des nationalen Fernverkehrs. Es fördert Investitionen in Ladeinfrastruktur.
EU und Bundesministerium investieren bundesweit in HoLa-Hochleistungsladeinfrastruktur für Lkw
Mit finanzieller Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums und der EU zählt der Hochleistungsladepunkt zu den Kernkomponenten des HoLa-Programms, das den Elektrifizierungsschub im gewerblichen Fernverkehr beschleunigt. Durch Installation leistungsstarker Ladeinfrastruktur entlang zentraler Routen wird eine praxisnahe Nutzung batterieelektrischer Lastkraftwagen ermöglicht. Effiziente Ladezyklen und optimierte Bedienprozesse senken Fahrzeugstillstandszeiten. Die daraus resultierende Verringerung des CO?-Ausstoßes im Schwerlastverkehr trägt wesentlich zu einer nachhaltigen Dekarbonisierungsstrategie im Logistiksektor bei. Fortlaufende Evaluierungen optimieren Leistung, Betriebskosten und Akzeptanz im Transportalltag.
Megawatt-Ladeleistung ermöglicht emissionsfreien Fernverkehr mit praktikabler Ladeinfrastruktur und Wirtschaftlichkeit
Mit der Einführung der Megawattladung eröffnet sich laut Prof. Patrick Plötz am Fraunhofer ISI eine neue Ära für batteriegetriebene Lkw im Güterfernverkehr. Ladeprozesse von nur 30 bis 45 Minuten bei Spitzenleistungen von 1,2 MW schaffen Reichweiten im Bereich mehrerer Hundert Kilometer. Diese technische Innovation steigert die Wettbewerbsfähigkeit elektrischer Fahrzeugflotten, verkürzt Standzeiten erheblich und ebnet den Weg für klimafreundliche Transportkonzepte auf nationalen und europäischen Fernverkehrsrouten, kontinuierlich von Logistikunternehmen aktiv genutzt werden.
Fraunhofer ISI P3 Group analysieren Wirtschaftlichkeit Nutzerakzeptanz im HoLa-Projekt
Unter Federführung des Fraunhofer ISI und der P3 Group steuert das HoLa-Konsortium sämtliche Projektphasen vom Konzept bis zur Erprobung. Die technische Realisierung der Schnellladeinfrastruktur bildet einen Schwerpunkt, flankiert von vertieften Netzstudien zur Integration in bestehende Energienetze. Ferner erfolgen systematische Standortanalysen unter Berücksichtigung verkehrlicher, topographischer und baukonstruktiver Aspekte. Abgerundet wird die Arbeit durch Wirtschaftlichkeitsprüfungen und empirische Erhebungen zur Nutzerakzeptanz mit anschließender Bewertung. Die gewonnenen Erkenntnisse liefern wertvolle Grundlagen für politische Entscheider.
HoLa-Projektpartner optimieren Ladeinfrastrukturplanung dank betrieblichem Praxiseinsatz im Scania E-Lkw
Im Rahmen des HoLa-Konsortiums setzen STI Freight Management Germany und Pape Transporte den neuen Megawatt-Ladepunkt für ihre Scania-Elektro-Lkw ein. Dabei werden Ladeleistung, Ladezyklen und betriebliche Abläufe lückenlos erfasst und analysiert. Die systematischen Feldversuchsergebnisse unterstützen die Entwicklung praxisorientierter Leitfäden für Betreiber und Versorger. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden bundes- und europaweite Ausbaupläne für Hochleistungsladeinfrastruktur optimiert, um den elektrischen Güterfernverkehr wirtschaftlich und nachhaltig voranzutreiben. Ergänzend fließen sie in normative Vorgaben zur Infrastrukturentwicklung.
Wissenschaftler aus Stuttgart, Weimar, Berlin und Dortmund begleiten Projekt
In Deutschland sollen vier leistungsfähige Megawatt-Ladepunkte entlang zentraler Autobahnabschnitte installiert werden, um die Ladeinfrastruktur für elektrische Nutzfahrzeuge flächendeckend zu gestalten. Initiatoren sind Hersteller Daimler Truck, MAN, Scania und Volvo in Partnerschaft mit Energiedienstleistern ABB E-mobility, Heliox, EnBW mobility+ sowie der Autobahn GmbH des Bundes. Wissenschaftliche Unterstützung leisten die Universität Stuttgart, die Bauhaus-Universität Weimar, die TU Berlin und die TU Dortmund mit Studien zu Netzstabilität, Verbrauchsanalysen und Betriebsabläufen, methodisch und praxisorientiert.
Schnelle Ladezeiten und praxisnahe Reichweiten sichern wirtschaftliche dauerhafte Elektrifizierung
Die Inbetriebnahme markiert einen wichtigen Beitrag zur Senkung der CO?-Emissionen im Straßengüterverkehr und unterstreicht den Übergang zu nachhaltigen Transportlösungen. Schnelle Ladezeiten von 30 bis 45 Minuten machen E-Lkw im Fernverkehr praktikabel und reduzieren Abhängigkeiten von fossilen Kraftstoffen. Mit der Kooperation von Herstellern, Energieversorgern und Forschungseinrichtungen wird der Ausbau einer zuverlässigen Hochleistungsladeinfrastruktur vorangetrieben, die langfristig zur Verkehrswende beiträgt und klima- sowie wirtschaftspolitische Ziele unterstützt. Dieses Pilotprojekt liefert wichtige Erkenntnisse für die flächendeckende Planung und Netzintegration.